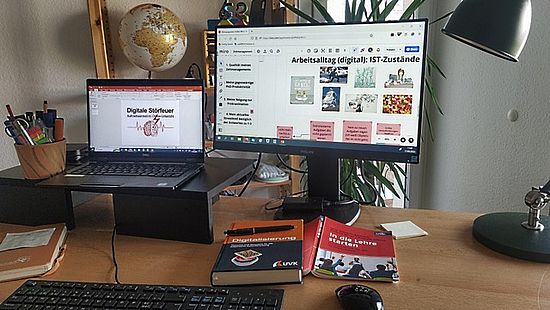
Digitalisierte Arbeitsrhythmen
Über das Forschungsprojekt
Ob Zoom, Outlook, Switch, Dropbox, WhatsApp oder Miro – digitale Medien- und Kommunikationstechnologien sind Ergebnisse anwendungsbasierter und interdisziplinärer Forschung und Entwicklung. Seit der Corona-Pandemie dominiert ihr Einsatz den Arbeitsalltag nochmals verstärkt. Von Dozierenden an Universitäten über Angestellte in Unternehmen bis hin zu Selbstständige in der Kreativbranche: Menschen koordinieren, kommunizieren und organisieren ihre Zeit zunehmend im Rahmen flexibler und mobiler Arbeitsmodelle. Auf diese Weise entstanden und entstehen «digitalisierte Arbeitsrhythmen», deren Verständnis sich das Forschungsprojekt zum Ziel gesetzt hat.
Forschungsfragen
Ausgangspunkt der Forschung ist eine «anthropology of emotions» (Langbein 2020; Beatty 2014). In spezifischen Fokusgruppen reflektieren mobil arbeitende Menschen zunächst, wie sich der Umgang mit Zeit vor dem Hintergrund ihrer digitalisierten Tätigkeiten gegenwärtig anfühlt. In einem zweiten Schritt wird dann gemeinsam herausgearbeitet, warum sie ihre (Arbeits-)Zeit emotional so wahrnehmen und welche Rolle hierbei die täglich verwendeten Technologien spielen. Folgende Forschungsfragen sollen in diesem Zusammenhang beantwortet werden:
- Über die Nutzung welcher Medien- und Kommunikationstechnologien wird Arbeitszeit getaktet und wie vollzieht sich dieser Prozess im Alltag?
- Wird Zeit aktiv gemanagt, und wenn ja: wie?
- Auf welche Weise und mit welchen Konsequenzen schreibt sie sich z. B. in den Körper ein?
- Welches Gesundheitswissen existiert, wie wird mit diesem Wissen umgegangen und mit welchen Folgen?
- Welche Vorstellungen von Produktivität dominieren und wie entfalten sich solche Vorstellungen in der Praxis?
- Wann und warum wird Zeit z. B. als «in/effizient» oder «un/stressig» erlebt und was bedeutet das im Hinblick auf den technologisierten Arbeitsalltag?
- Inwiefern sind die beobachteten digitalisierten Arbeitsrhythmen klassenspezifisch, ethnisiert oder vergeschlechtlicht?
Methoden
Empirisch geforscht wird im Rahmen von «Alltagslaboren» (vgl. zum Konzept das hier zum Download beigefügte PDF). Jedes Labor umfasst ein Set unterschiedlicher Akteurs- und Medienkonstellationen bestehend aus je 6-8 Personen sowie einem Netzwerk spezifischer digitaler Applikationen, die diese Personen im Alltag nutzen. Dabei werden alle an einem Alltagslabor beteiligten Personen als «epistemic partners» verstanden (vgl. Holmes/Marcus 2008), d. h. im Sinne einer «collaborative anthropology» (Boyer/E. Marcus 2017) werden sie nicht als eine Quelle von Wissen gesehen, die Forschende abschöpfen, sondern als Ko-Produzierende von Erkenntnissen, mit denen gemeinsam analytische und konzeptionelle Arbeit betrieben wird. In den Laboren werden u. a. folgende qualitative Methoden eingesetzt: Workshops, Gruppengespräche, leitfadengestützte Interviews, Mental Maps und teilnehmende Beobachtungen. Sampleübergreifend laufen ausserdem «autoethnographische Forschungen» (Ploder/Stadlbauer 2016; Allen‐Collinson 2011).
Output
Neben der Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen ist auch eine übergreifende Applizierung in Arbeit. Dabei werden Forschungsprozesse und -ergebnisse aus den Alltagslaboren in einem Best-Practise-Guide festgehalten und über praxisorientierte Trainings weitergegeben.
Weitere Informationen
Quick Links
